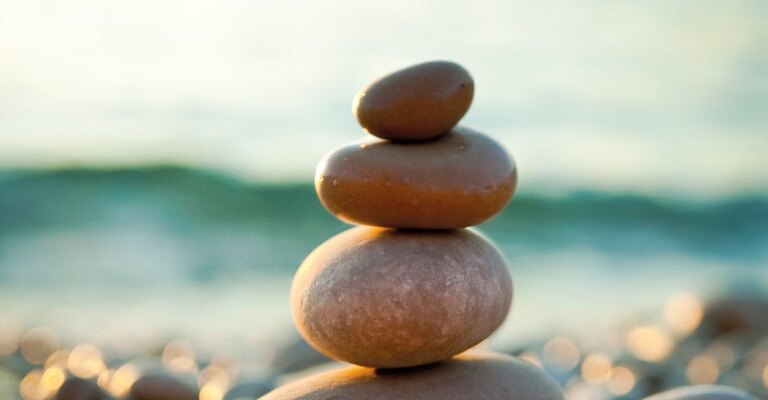Sucht
Der schleichende Prozess in die Abhängigkeit

Alles, was Sie über Sucht wissen müssen
Ein Glas Wein, eine Zigarette oder der Blick in die sozialen Netzwerke – viele Menschen konsumieren Stoffe oder Medien, die süchtig machen können. Doch nicht alle entwickeln eine Abhängigkeit. Warum werden manche süchtig, andere nicht? Hier erfahren Sie, wie eine Sucht entsteht, ab wann sie als behandlungsbedürftig gilt und welche Hilfsangebote Betroffenen zur Verfügung stehen.
Das Wichtigste in Kürze
- Sucht ist eine Erkrankung, bei der das Verlangen nach einem bestimmten Stoff oder einer Tätigkeit den Alltag bestimmt.
- Sucht hat gravierende Auswirkungen auf die Betroffenen, ihr soziales Umfeld und die gesamte Volkswirtschaft.
- Süchtige benötigen professionelle Hilfe. Je früher die Behandlung beginnt, desto besser sind die Erfolgsaussichten.
Das Krankheitsbild
Der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) e.V. zufolge hat in Deutschland jede zehnte Person ein Suchtproblem. Der Begriff „Sucht“ beschreibt einen Zustand, in dem Menschen die Kontrolle über ihr Verhalten verlieren. Trotz negativer Folgen können sie nicht aufhören, ein bestimmtes Mittel zu konsumieren oder eine bestimmte Handlung auszuführen. Dabei ist es wichtig, zwischen einer harmlosen Gewohnheit und einer echten Abhängigkeit zu unterscheiden: Während Gewohnheiten bewusst durchgeführt und kontrollierbar sind, zeichnet sich eine Sucht durch den Zwang zur Wiederholung und durch körperliche oder psychische Entzugserscheinungen aus.
Formen von Sucht
Suchterkrankungen lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen:
Bei einer stoffgebundenen Abhängigkeit sind Betroffene abhängig von einer bestimmten Substanz. Laut Epidemiologischem Suchtsurvey (ESA), der regelmäßig den Konsum von psychoaktiven Substanzen der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland ermittelt, pflegten im Jahr 2021 Millionen Menschen einen problematischen Konsum, der bereits negative Folgen haben und auf eine Abhängigkeit hinweisen kann:
- 9 Millionen Menschen von Alkohol,
- 4 Millionen Menschen von Tabak,
- 2,9 Millionen Menschen von psychoaktiven Medikamenten und
- 1,3 Millionen Menschen von Cannabis.
Stoffgebundene Süchte sind als behandlungsbedürftige Gesundheitsstörung anerkannt.

Im Falle einer Verhaltenssucht sind Betroffene nicht von stofflichen Substanzen, sondern von alltäglichen Tätigkeiten abhängig. Als solche erfasst, wird beispielsweise wird das pathologische Glücksspiel, Computerspielen oder ein problematischer Social-Media-Konsum. Auch eine Kaufsucht, Arbeitssucht oder sexuelle Abhängigkeit können je nach Schweregrad diagnostiziert und behandelt werden.

Phasen einer Sucht
Eine Sucht entsteht nicht über Nacht, sondern entwickelt sich über einen meist längeren Zeitraum. Dieser Prozess lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen, die ineinander übergehen können:
Kennenlernen: Einer Sucht geht immer ein erster, oft freiwilliger Konsum voraus. Meistens geht es darum, die Neugier zu befriedigen und findet häufig in Gesellschaft statt. Manche Menschen hören danach auf, andere bleiben dran und nehmen ein Mittel öfter.
In der Experimentierphase wird der Konsum oder das Verhalten regelmäßiger. Die betroffene Person entdeckt eigene Vorlieben, zum Beispiel verschiedene Geschmacksrichtungen beim Alkohol oder beim Rauchen. Die positiven Effekte wie Entspannung, Freude oder soziale Zugehörigkeit überwiegen, mögliche Risiken werden ausgeblendet.
In der Gewöhnungsphase wird der Konsum oder das Verhalten zur Normalität und nimmt einen festen Platz im Alltag ein. Es entwickelt sich eine psychische Abhängigkeit, bei der die betroffene Person das Suchtmittel oder -verhalten zur Gefühlsregulation verwendet, beispielsweise zur Entspannung oder gegen Langeweile. Erste soziale, schulische oder berufliche Probleme können auftreten.
In der Abhängigkeitsphase ist der Konsum oder das Verhalten außer Kontrolle geraten. Das Motiv hat sich verschoben: das Suchtmittel wird benötigt, um sich besser zu fühlen, und wird häufiger und in größeren Mengen konsumiert. In diesem Stadium lässt sich der Konsum kaum noch verheimlichen, da Probleme mit der Schule, der Arbeit, Beziehungen und der Gesundheit entstehen. Oft ist die Einsicht in das Problem vorhanden, aber das Aufhören gelingt selten.
In der letzten Phase bestimmt der Konsum oder das Verhalten den Alltag vollständig. Körperliche Schäden, soziale Isolation, finanzielle oder berufliche Probleme sind oft weit fortgeschritten. Die betroffene Person braucht das Suchtmittel nicht mehr nur zur Belohnung, sondern vor allem, um Entzugserscheinungen zu vermeiden.
Gründe für eine Sucht
Menschen können aus verschiedenen Gründen süchtig werden. Ein zentraler Mechanismus spielt jedoch immer eine entscheidende Rolle: das sogenannte Belohnungszentrum im Gehirn. Es registriert positive Erfahrungen und motiviert uns, sie zu wiederholen. Dieses Prinzip hat sich in der Evolution bewährt, denn es unterstützt das Überleben, indem es nützliches Verhalten belohnt. Das Gehirn lernt schnell, welche Reize besonders glücklich machen, und entwickelt ein starkes Verlangen danach, diese Reize erneut zu erleben. Hier kommt Dopamin ins Spiel: Es verstärkt das Verlangen und lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Belohnung.
Bestimmte Substanzen oder Verhaltensweisen können das Belohnungszentrum besonders stark aktivieren. Mit der Zeit stumpft es aber ab, sodass immer mehr Reize nötig sind, um denselben Effekt zu erzielen. Dieser Prozess wird als Toleranzerhöhung bezeichnet. Der Drang, den Kick erneut zu erleben, kann so stark werden, dass wichtige Lebensbereiche an Bedeutung verlieren und die betroffene Person die Kontrolle über ihr Verhalten verliert.
Wichtig zu wissen: Nicht alle Menschen werden süchtig. Es gibt durchaus Personen, die nach dem ersten Probieren einer Substanz direkt aufhören oder Tätigkeiten ohne Gewöhnungseffekt ausüben.
Ob sich eine Abhängigkeit entwickelt, hängt von drei Faktoren ab, die das sogenannte Suchtdreieck beschreibt:
- der Person selbst,
- ihrem sozialen Umfeld und
- dem Suchtmittel.
Das Modell besagt, dass eine Suchterkrankung meist dann entsteht, wenn alle drei Bereiche kritische Faktoren beinhalten und gleichzeitig zusammentreffen. Umgekehrt kann ein schützender Faktor in einem der drei Bereiche das Risiko deutlich verringern, zum Beispiel eine stabile Familiensituation oder eine hohe persönliche Resilienz.
-
Studien mit Zwillingen und Adoptivkindern zeigen, dass genetische Faktoren bei der Entstehung von Suchterkrankungen eine Rolle spielen können. Auch das Selbstwertgefühl beeinflusst das Suchtverhalten: Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind, haben ein geringeres Risiko, abhängig zu werden. Wer dagegen unter innerer Anspannung, Ängsten oder negativen Gefühlen leidet, greift häufiger zu Suchtmitteln oder sucht in bestimmten Verhaltensweisen kurzfristige Erleichterung. Auch traumatische Erfahrungen oder psychische Erkrankungen können das Risiko für eine Sucht deutlich erhöhen.
-
Einen weiteren großen Einfluss hat das soziale Umfeld: Menschen in einem stabilen Umfeld greifen seltener zu Drogen. Wer hingegen ein Umfeld hat, in dem Suchtmittel leicht verfügbar sind, problematischer Konsum verharmlost wird oder Vernachlässigung, Gewalt oder Ausgrenzung ausgesetzt ist, hat ein deutlich höheres Risiko, abhängig zu werden. Vor allem bei Jugendlichen kann Gruppendruck den Einstieg in riskanten Konsum fördern.
-
Nicht alle Suchtmittel wirken gleich: Manche wirken stärker auf das Belohnungssystem als andere und haben damit ein höheres Suchtpotenzial. Zudem spielt die Verfügbarkeit eine Rolle: Was leicht zugänglich und gesellschaftlich akzeptiert ist – wie Alkohol oder digitale Medien – wird häufiger konsumiert und birgt damit ein höheres Risiko für Missbrauch.
Folgen von Sucht
Sucht bleibt nicht ohne Folgen, wobei sich die Auswirkungen von stoffgebundenen und nicht stoffgebundenen Süchten unterscheiden.
Stoffgebundene Süchte: Der exzessive Konsum von Suchtmitteln zeigt sich vor allem körperlich: Er kann die Organe der Betroffenen schädigen, diverse Krankheiten begünstigen und langfristig sogar zum Tod führen. Die meisten Todesfälle verursacht noch immer Tabak: Den Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums zufolge sterben in Deutschland jährlich mehr als 127.000 Menschen daran, etwa 40.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums. An drogenbedingten Todesfällen hat das Bundeskriminalamt 2023 rund 2.230 registriert – etwa doppelt so viele wie vor zehn Jahren und rund zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus können Betroffene auch ihr soziales Umfeld vernachlässigen, da Beziehungen, Arbeit und Alltagsorganisation oft unter der Sucht leiden.
Nicht stoffgebundene Süchte: Exzessives Videospielen oder intensiver Social-Media-Konsum geht nicht nur mit einem hohen Zeitaufwand einher, sondern kann dazu führen, dass Betroffene den Tagesablauf, ihre sozialen Kontakte und die Kontrolle darüber, wie oft und wie lange sie spielen oder online sind, vernachlässigen. Übermäßiges Glücksspiel kann zusätzlich finanzielle Probleme verursachen.
Auch die psychische Gesundheit kann leiden. Viele Süchtige entwickeln Depressionen und Angststörungen. Daneben kann Sucht zu Problemen am Arbeitsplatz, Konflikten in der Familie oder Isolation im Freundeskreis führen. Auch Co-Abhängigkeit ist ein Problem: Angehörige von suchtkranken Menschen – häufig Partnerinnen, Partner oder Eltern – geraten oft selbst in einen belastenden Kreislauf. Sie versuchen, das Verhalten des oder der Abhängigen zu verheimlichen oder auszugleichen, und verlieren dabei oft die eigenen Bedürfnisse aus dem Blick.

Hilfe bei Sucht
Betroffene finden den Ausweg aus der Sucht oft nicht allein und benötigen professionelle Hilfe. Prinzipiell ist eine Sucht behandelbar. Die Therapie einer Suchterkrankung richtet sich nach Art und Schwere der Abhängigkeit. Ziel ist es, den Konsum zu reduzieren oder ganz zu beenden und Rückfällen vorzubeugen. In vielen Fällen beginnt die Behandlung mit einer Entgiftung, also dem körperlichen Entzug. Daran schließen sich oft ambulante oder stationäre Rehabilitationsmaßnahmen an, die psychotherapeutische Gespräche, Gruppenangebote und medizinische Betreuung umfassen. Auch Selbsthilfegruppen können Betroffene langfristig stabilisieren.
Sollten Sie oder Ihre Angehörigen dringend Hilfe benötigen, können Sie sich an folgende Stellen wenden:
- Telefonseelsorge (24/7, anonym und kostenlos): 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
- Sucht & Drogen Hotline (täglich von 8 bis 24 Uhr): 01805 31 30 31
- Deutsches Rotes Kreuz (bundesweites Sorgentelefon für Angehörige von Menschen mit Suchtproblemen): 06062 607-670
FAQ: Häufig gestellte Fragen zu Sucht
-
Eine Sucht ist eine behandlungsbedürftige Erkrankung, bei der Betroffene die Kontrolle über ihr Verhalten verlieren. Sie verspüren ein starkes Verlangen nach bestimmten Substanzen oder Tätigkeiten, obwohl diese negative Folgen haben. Sucht verändert das Belohnungssystem im Gehirn und beeinflusst Denken, Fühlen und Handeln.
-
Man unterscheidet zwischen stoffgebundenen Süchten wie Alkohol-, Nikotin- oder Drogenabhängigkeit und nicht stoffgebundenen Verhaltenssüchten. Dazu zählen etwa Glücksspiel, exzessives Computerspielen oder ein problematischer Social-Media-Konsum. Beide Formen können schwerwiegende körperliche, psychische und soziale Folgen haben.
-
Eine Abhängigkeit liegt vor, wenn von folgenden sechs Kriterien mindestens drei innerhalb des zurückliegenden Jahres erfüllt sind:
- starker Wunsch und/oder Zwang, eine Substanz zu konsumieren oder eine Handlung auszuführen
- eingeschränkte Kontrolle über Beginn, Menge und/oder Beendigung des Konsums
- körperliche Entzugssymptome
- Toleranzentwicklung (Wirkverlust) und Dosissteigerung
- zunehmender Zeitaufwand für Beschaffung, Konsum oder Erholung vom Konsum, verbunden mit der Vernachlässigung anderer Interessen
- fortgesetzter Konsum trotz Folgeschäden